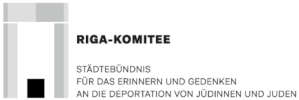Meldung
Meldung
Ge(h)denken – Monat des Kriegsgrabs
Im September 2025 lädt der Volksbund NRW wieder zur Beschäftigung mit Kriegsgräberstätten ein
Essen. „Ge(h)denken“ geht in die vierte Runde. Auch im Jahr 2025 ruft der Landesverband NRW den September zum „Monat des Kriegsgrabes“ aus und lädt dazu ein, Kriegsgräberstätten als Erinnerungsorte zu entdecken oder sich bei Vorträgen über verschiedene verwandte Themen zu informieren. Insgesamt 17 kostenlose Veranstaltungen bietet der Volksbund NRW gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen im September 2025 an.
Anlässe sind Gedenktage wie der Antikriegstag am 1. September, der internationale Tag des Friedens am 21. September sowie Aktionstage wie der „Tag des offenen Denkmals“ am 15. September und der „Tag des Friedhofs“ am 20./21. September. Aber auch das Ende des Zweiten Weltkrieges, das sich in diesem Jahr bereits zum 80. Mal jährte, spielt eine Rolle.
"Frieden und Demokratie sind nicht selbstverständlich“, sagt der Vorsitzende des Volksbundes NRW, Thomas Kutschaty. „Das zeigen nicht nur die aktuellen Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Dafür stehen auch mehr als 330.000 Gräber beider Weltkriege bei uns in Nordrhein-Westfalen. 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges müssen wir daran wieder stärker erinnern.“
So finden auf insgesamt 11 Friedhöfen Führungen zu dort gelegenen Kriegsgräberstätten statt, u.a. in Bocholt, Bochum und Bielefeld. Stadtspaziergänge zu erinnerungskulturellen Themen werden in Köln und in Münster angeboten. Und bei Hörstel am Teutoburger Wald kann man gleich drei Kriegsgräberstätten bei einer Wanderung entdecken.
Nicht nur unter freiem Himmel gibt es Angebote. Umrahmt werden sie durch Vorträge, z.B. im Herner Emschertal-Museum über „Kriegsbiographien-Ego-Dokumente in der Arbeit des Volksbundes“. In Herford kann man sich über „80 Jahre Kriegsende, Niederlage und Befreiung in Herford und zur Geschichte und Zukunft der Erinnerungskultur“ informieren. In Hövelhof wird ein internationales Recherche- und Dokumentationsprojekt des Volksbundes zu sowjetischen und deutschen Kriegsgefangenen und Internierten vorgestellt. In Dülmen kann man die aktuelle Wanderausstellung des Riga-Komitees „Deportationen – Tatorte – Erinnerungskultur“ besichtigen.
Alle Angebote sind in einem Faltblatt zusammengefasst, dass man hier herunterladen kann.
Auch auf eigene Faust kann man Kriegsgräberstätten erkunden – mit Hilfe der App „Actionbound“. Einige Kriegsgräberstätten lassen sich so mit Hilfe des eigenen Smartphones erschließen. Die jeweiligen Orte findet man hier.
Im Rahmen einer Mitmachaktion kann man auch eigene Zeichen setzen – auf einem Grab eine Blume oder einen Stein des Erinnerns hinterlegen, davon ein Foto in den sozialen Medien posten oder mit dem Volksbund-Profil VolksbundNRW2.0 verlinken.
Ein Land voller Massengräber und kaum jemand, der noch einen Kaddisch sagen kann: Auf den Spuren der Shoah in Lettland

Im September 2024 unternahmen Mitarbeitende der Gedenkstätten sowie Mitglieder des Gedenkstättenvereins und MultiplikatorInnen aus dem Osnabrücker Raum und Berlin vom 26. August bis 1. September 2024 eine Reise nach Litauen und Lettland zu Orten der Shoah im Baltikum. Die Reise erfolgte im Rahmen der Ausstellung "Der Tod ist ständig unter uns. Die Deportationen nach Riga und der Holocaust im deutsch besetzten Lettland", die vom 7. April bis 1. September 2024 in der Gedenkstätte Augustaschacht zu sehen war. Die Autorin war eingeladen worden, an dieser Reise teilzunehmen. Sie stellt uns ihren Bericht für diese Veröffentlichung kostenfrei zur Verfügung.
Am 13. Dezember 1941 wurden 35 Osnabrückerinnen und Osnabrücker gezwungen, in einen Zug zu steigen, der sie in mehrtägiger Fahrt nach Riga in Lettland brachte. Sie selber kannten das Ziel nicht. Ihren Besitz mussten sie zurücklassen. Fünfzig Kilo an Gepäck waren alles, was sie mitnehmen durften, und auch wurde ihnen bei der Ankunft weggenommen, als sie mit Eisenstangen aus dem Zug in die eisige Kälte von minus 30 bis 40 Grad geprügelt wurden. Kleine Kinder und alle, die den weiten Weg in das Ghetto nicht schafften, wurden gleich ermordet. „Keiner von uns hat geglaubt, dass so viel Sadismus möglich war“ – dieser Satz stammt von Ewald Aul, einem der fünf Osnabrücker Überlebenden dieser Deportation, später langjähriger Vorsitzender der Jüdischen Nachkriegsgemeinde in Osnabrück.
Diese Reise war nicht leicht, manche Eindrücke nur schwer zu verkraften Es war eine Reise auf den Spuren von Massenmorden, die auch emotional belastete, und dennoch eine Reise mit vielen wertvollen Begegnungen mit Menschen, die sich dafür engagieren, die Menschen, die diesen Morden zum Opfer fielen, der Vergessenheit zu entreißen, wo das noch möglich ist, und ihnen dadurch ihre Würde zurückzugeben. Unter diesen Ermordeten, für die niemand das Kaddisch, das jüdische Totengebet, sprach, sind 30 Osnabrückerinnen und Osnabrücker. Drei davon, die Geschwister Edith, Carl und Ruth-Hanna Stern, waren noch kleine Kinder.
Am 31. Juli 1941 wurde der Leiter des Reichssicherheitshauptamts, Reinhard Heydrich, von Reichswirtschaftsminister Hermann Göring mit der Vorbereitung der Endlösung der Judenfrage beauftragt, der systematischen Ermordung aller europäischen Juden. Im Oktober 1941 ordnete Hitler die Deportation der jüdischen Bürgerinnen und Bürger aus dem Reichsgebiet an. Sie wurden in Transporten von je 1.000 Personen in die Ghettos Lodz in Polen, und Minsk in Belarus, Kaunas und Vilnius in Litauen und das lettische Riga gebracht.
In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion wurde der Holocaust über Jahrzehnte verdrängt und tabuisiert. Neue Verbrechen durch das stalinistische Regime überlagerten die Erinnerung an die deutsche Besatzung und die Verfolgung von jüdischen Menschen und anderen Bevölkerungsgruppen. Für die Sowjetunion gab es keine jüdischen Opfer und damit auch keinen Holocaust. Die Ermordeten waren alle Sowjetbürgerinnen und -bürger. Es ging um Heldengedenken, alle Toten galten gleichermaßen als „Opfer des Faschismus“. Die Erinnerung an die massive Beteiligung der einheimischen Bevölkerung an den Morden wird den Litauern und Letten auch heute kaum zugemutet.