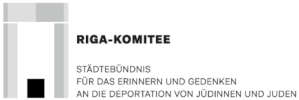Meldung
Meldung
Freuen sich über die Nominierung zum deutschen Lehrkräftepreis (v.l. hinten): Monika Bannenberg, Stefan Heithorst, Fabian von der Osten, Roman Rennert, (vorne v.l.): Katrin Noga und Nicole Köchling-Dicke (© Julia Hollwedel (LWL-Klinikum Marsberg))
Inklusive Erinnerungskultur erfolgreich gestalten
Marsberger Kooperationsprojekt mit dem Volksbund für den deutschen Lehrkräftepreis nominiert
Marsberg. Bereits seit ein paar Jahren steht die Bildungsreferentin des Volksbundes im Bezirksverband Arnsberg, Vanessa Schmolke, in einem engen Austausch mit der LWL-Klinik in Marsberg. Ausgehend vom Anstaltsfriedhof und den dortigen Kriegsgräbern haben sich neben Führungen zum Monat des Kriegsgrabes im September auch Projekte mit Schulen vor Ort ergeben. Ein Projekte wurde zuletzt sogar für den deutschen Lehrkräftepreis nominiert. Lesen Sie dazu den folgenden Artikel von Julia Hollwedel vom LWL:
„Das Projekt ‘Echo der Vergangenheit: Mit einer inklusiven Erinnerungskultur Demokratie und Zivilcourage stärken!’ der Klinik-Schule am Bomberg des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und der Sekundarschule Marsberg wurde für den ‘Deutschen Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ’ in der Kategorie fächerübergreifende Projekte und neuartige Formen des gemeinsamen Lernens nominiert. Bei der Preisverleihung in Berlin gab es zwar keinen Preis, aber dafür ganz viel Lob und Wertschätzung.
Monika Bannenberg, Lehrerin an der Sekundarschule, und Nicole Köchling-Dicke, Schulleiterin der LWL-Schule, sagen: ‘Allein die Nominierung ist ein starkes Zeichen und eine schöne Form der Anerkennung des Projekts. Unser Ziel ist es, nicht nur unsere Geschichte vor Ort erlebbar zu machen, sondern auch auf den Aspekt der Zivilcourage einzugehen. Jeder Einzelne von uns kann etwas bewirken.’
In Zusammenarbeit mit dem LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge organisieren Lehrkräfte der beiden Schulen für die Schülerinnen und Schüler der Marsberger Sekundarschule jährlich Projekttage.
In Workshops, die im Rotationsprinzip durchlaufen werden, setzen sich die Schüler:innen intensiv mit den ‘Euthanasie’-Verbrechen im Nationalsozialismus und dem historischen Friedhof der Marsberger LWL-Einrichtungen an der Bredelarer Straße auseinander. Die Workshops verbinden Theorie und Praxis. Lehrerin Monika Bannenberg gibt eine Einführung in das Thema ‘Euthanasie’ im Nationalsozialismus mit Schwerpunkt auf der Aktion T4. Beim Quellenstudium mit Roman Rennert lesen, sammeln und sichten die Schüler:innen historische Quellen. Mit Stefan Heithorst erstellen die Jugendlichen einen Podcast. Mit Fabian von der Osten und Katrin Noga geht es auf den Friedhof, um die Grabsteine mit Wurzelbürste und Wasser von Moos zu befreien. Beim Saubermachen bringen Namen sowie Geburts- und Sterbedaten insbesondere der in jungen Jahren Verstorbenen die Schüler:innen ins Nachdenken.
Mit Acrylstiften gestalten die Jugendlichen Gedenksteine, die später als kleine Kunstwerke an den Gräbern niedergelegt werden. Die Schüler:innen entscheiden sich für verschiedene Motive: Bunte Blumen, poetische Zeilen, Regenbögen oder Sonnen. Vanessa Schmolke, Bildungsreferentin beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, hat im LWL-Archivamt für Westfalen in Münster über 50 Patientenakten gesichtet. Sie stellt stellvertretend für so viele einzelne Schicksale einige Biografien vor. Zum Beispiel die Lebensgeschichte von Maria M.B., deren Grabstein auf dem Marsberger Friedhof unweit des Gedenksteins zu finden ist. Als Abschluss der Projekttage lassen alle Beteiligten biologisch abbaubare Luftballons in den Himmel steigen. Der Wind trägt die Ballons über das Gebäude des damaligen St. Johannes-Stifts, heute Sitz der Verwaltung des Wohnverbundes, davon.
‘Die Resonanz unserer Schülerinnen und Schüler ist sehr positiv’, so Monika Bannenberg. ‘Das Rotationsprinzip und die verschiedenen Workshops sind eine andere Form von Unterricht und politischer Bildung, die ausgezeichnet im Gedächtnis bleibt. Die Schüler erleben Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes zum Anfassen.’
Andrea Engelmann, Leiterin des LWL-Wohnverbundes Marsberg, sagt: ‘Geschichte ist auch dazu da, um aus der Vergangenheit zu lernen. In unruhigen Zeiten ist das wichtiger denn je. Wir freuen uns, über das Geschichtsinteresse der nächsten Generation, die auf dem >Gesundheitscampus Bredelarer Straße< eindrucksvolle Projekttage erleben und somit dazu beitragen, dass unsere Geschichte nicht verloren geht. Solche Erfahrungen prägen und stärken unsere Gesellschaft.’
Marsbergs Bürgermeister Thomas Schröder schließt sich an: ‘Der LWL und Marsberg sind seit über 200 Jahren miteinander verwoben. Die Geschichte des Standortes ist auch ein Teil der Stadtgeschichte. Besonders freue ich mich über die Kooperation der Lehrkräfte beider Schulen. Die Nominierung für den Deutschen Lehrkräftepreis ist eine schöne Motivation. Und noch etwas verbindet Marsberg und den LWL: Gemeinschaft und Zusammenhalt.’
Geschichtlicher Hintergrund
Im November 1940 entstand im Rahmen des sogenannten ‘Euthanasieprogramms’ im St. Johannes-Stift, Vorgänger des LWL-Klinikums Marsberg, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie des LWL-Wohnverbundes Marsberg, in Marsberg eine ‘Kinderfachabteilung’. Auf Geheiß des ‘Reichsausschusses zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden’ wurden dort in den folgenden Monaten etwa 50 Kinder und Jugendliche durch die überdosierte Gabe von Medikamenten gezielt betäubt und getötet. Zu diesem Zweck wurde regimetreues Pflegepersonal von Berlin nach Marsberg verlegt. Bereits 1941 wurde die Kinderfachabteilung offiziell geschlossen. Tatsächlich wurde die Abteilung in die Heil- und Pflegeanstalt Dortmund-Aplerbeck verlegt - offenbar wegen Unruhe in der Marsberger Bevölkerung.“
Foto und Text: Julia Hollwedel (LWL-Klinikum Marsberg)
Ein Land voller Massengräber und kaum jemand, der noch einen Kaddisch sagen kann: Auf den Spuren der Shoah in Lettland

Im September 2024 unternahmen Mitarbeitende der Gedenkstätten sowie Mitglieder des Gedenkstättenvereins und MultiplikatorInnen aus dem Osnabrücker Raum und Berlin vom 26. August bis 1. September 2024 eine Reise nach Litauen und Lettland zu Orten der Shoah im Baltikum. Die Reise erfolgte im Rahmen der Ausstellung "Der Tod ist ständig unter uns. Die Deportationen nach Riga und der Holocaust im deutsch besetzten Lettland", die vom 7. April bis 1. September 2024 in der Gedenkstätte Augustaschacht zu sehen war. Die Autorin war eingeladen worden, an dieser Reise teilzunehmen. Sie stellt uns ihren Bericht für diese Veröffentlichung kostenfrei zur Verfügung.
Am 13. Dezember 1941 wurden 35 Osnabrückerinnen und Osnabrücker gezwungen, in einen Zug zu steigen, der sie in mehrtägiger Fahrt nach Riga in Lettland brachte. Sie selber kannten das Ziel nicht. Ihren Besitz mussten sie zurücklassen. Fünfzig Kilo an Gepäck waren alles, was sie mitnehmen durften, und auch wurde ihnen bei der Ankunft weggenommen, als sie mit Eisenstangen aus dem Zug in die eisige Kälte von minus 30 bis 40 Grad geprügelt wurden. Kleine Kinder und alle, die den weiten Weg in das Ghetto nicht schafften, wurden gleich ermordet. „Keiner von uns hat geglaubt, dass so viel Sadismus möglich war“ – dieser Satz stammt von Ewald Aul, einem der fünf Osnabrücker Überlebenden dieser Deportation, später langjähriger Vorsitzender der Jüdischen Nachkriegsgemeinde in Osnabrück.
Diese Reise war nicht leicht, manche Eindrücke nur schwer zu verkraften Es war eine Reise auf den Spuren von Massenmorden, die auch emotional belastete, und dennoch eine Reise mit vielen wertvollen Begegnungen mit Menschen, die sich dafür engagieren, die Menschen, die diesen Morden zum Opfer fielen, der Vergessenheit zu entreißen, wo das noch möglich ist, und ihnen dadurch ihre Würde zurückzugeben. Unter diesen Ermordeten, für die niemand das Kaddisch, das jüdische Totengebet, sprach, sind 30 Osnabrückerinnen und Osnabrücker. Drei davon, die Geschwister Edith, Carl und Ruth-Hanna Stern, waren noch kleine Kinder.
Am 31. Juli 1941 wurde der Leiter des Reichssicherheitshauptamts, Reinhard Heydrich, von Reichswirtschaftsminister Hermann Göring mit der Vorbereitung der Endlösung der Judenfrage beauftragt, der systematischen Ermordung aller europäischen Juden. Im Oktober 1941 ordnete Hitler die Deportation der jüdischen Bürgerinnen und Bürger aus dem Reichsgebiet an. Sie wurden in Transporten von je 1.000 Personen in die Ghettos Lodz in Polen, und Minsk in Belarus, Kaunas und Vilnius in Litauen und das lettische Riga gebracht.
In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion wurde der Holocaust über Jahrzehnte verdrängt und tabuisiert. Neue Verbrechen durch das stalinistische Regime überlagerten die Erinnerung an die deutsche Besatzung und die Verfolgung von jüdischen Menschen und anderen Bevölkerungsgruppen. Für die Sowjetunion gab es keine jüdischen Opfer und damit auch keinen Holocaust. Die Ermordeten waren alle Sowjetbürgerinnen und -bürger. Es ging um Heldengedenken, alle Toten galten gleichermaßen als „Opfer des Faschismus“. Die Erinnerung an die massive Beteiligung der einheimischen Bevölkerung an den Morden wird den Litauern und Letten auch heute kaum zugemutet.